Connecting the dots – Warum wir öfter zurückblicken sollten, um besser nach vorne schauen zu können
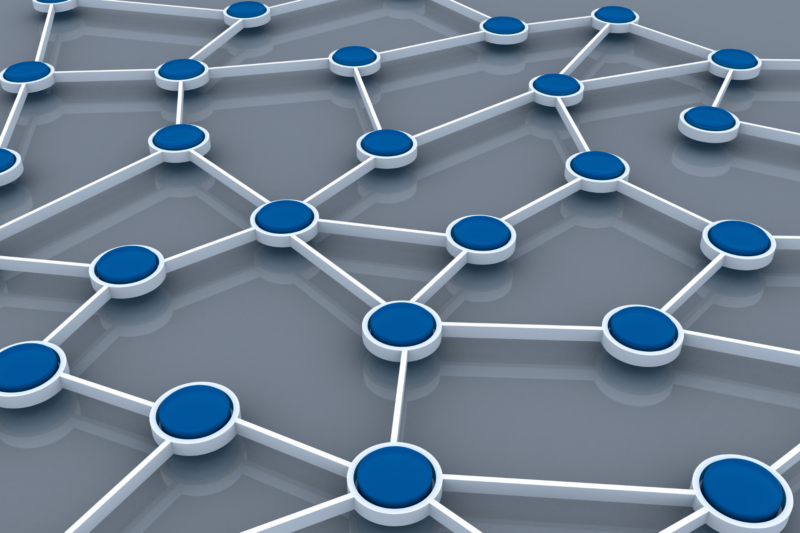
03.06.2022 – Ein Beitrag von René Schäfer
Der Bürgermeister des Silicon Valley
Vor den heutigen Einhörnern und milliardenschweren Risikokapitalgebern, vor Google, Facebook und Amazon, vor den ganzen vergessenen Dot-Coms, vor Apple und Microsoft, sogar vor Intel, Cisco und Sun gab es im Silicon Valley Tech-Unternehmen im modernen Sinne.
Mitten drin statt nur dabei war zu dieser Zeit Robert Noyce, geboren 1927, Sohn eines Pfarrers, mit einem Doktortitel des MIT und einem so schnellen Verstand, dass seine Freunde ihn „Rapid Robert“ nannten. Noyce gehört zu den Menschen, von denen man sagt, dass sie zu den wichtigen Personen der jüngeren Geschichte gehören, von denen die meisten Menschen aber noch nie etwas gehört haben.
Warum? Nun, er hat den ersten praktischen integrierten Schaltkreis entwickelt. Ohne diese Entwicklung gäbe es heute kein Metaverse, kein World Wide Web, keine Smartphones, Laptops, Smartwatches oder Herzschrittmacher, Geldautomaten, Videospiele und andere hippe Dinge. Zudem war Noyce ein Urvater der modernen Startupunternehmen von heute. Gemeinsam mit sieben Kollegen, alle in ihren Mittdreißigern, gründete er 1957 seine eigene Transistorfirma mit dem Namen Fairchild Semiconductor, welches heute noch existiert und innerhalb von zehn Jahren bereits elftausend Mitarbeiter hatte.
Noyce gehörte nicht nur zum Schlag unbekannte Helden. Er war auch eher ein Gründungspionier als ein Mann, der gerne ein großes Unternehmen leitete. Sein lesenswertes Kündigungsschreiben aus dem Jahr 1968 steht dafür stellvertretend. Nachdem er seinen Hut genommen hatte, gründete er mit seinem Fairchild-Mitbegründer Gordon Moore und Andy Grove ein kleines Speicherunternehmen, das sie Intel nannten. Und ähnlich wie Fairchild bauten sie das Unternehmen in den kommenden Jahren zu einer Weltmacht aus.
Aber auch Intel wurde Noyce irgendwann “zu groß”. Ab 1975 widmete er sich deswegen der nächsten Generation von Hightech-Unternehmern und saß in den Vorständen von einem halben Dutzend Startup-Unternehmen und versuchte sich als pragmatischer Risikokapitalgeber, der wichtige Unternehmensunterlagen in Schukartons in seinem Schrank aufbewahrte.
You can’t connect the dots looking forward
Es war in den späten 70ern, als Robert Noyce den jungen Steve Jobs kennenlernte, der über Robert Noyce etwas sagen sollte, was mich bis heute fasziniert:
„Bob Noyce nahm mich unter seine Fittiche. Ich war jung, in meinen Zwanzigern. Er war Anfang fünfzig. Er versuchte, mir einen Überblick zu vermitteln, mir eine Perspektive zu geben, die ich damals nur teilweise verstehen konnte. Man kann nicht wirklich verstehen, was heute passiert, wenn man nicht versteht, was vorher war.“
Dieser letzte Satz, den Jobs Jahrzehnte später in seinen eigenen eloquenten Worten in der 114. Eröffnungsrede der Stanford University in abgewandelter Form zitierte – You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward – beschäftigt mich fast jeden Tag.
Als jemand, der sich beruflich mit neuen Entwicklungen, Marktverschiebungen und Zukunftshypothesen beschäftigt, ist mein Blick natürlich nach vorne gerichtet. Generell macht es uns bei hy eine Menge Spaß, über die Zukunft nachzudenken. Manchmal blicken wir sogar zu tief in den Abgrund Zukunft.
Der Rat von Noyce an Jobs erinnert mich regelmäßig daran, dass die Vergangenheit mindestens genauso wichtig für die Gegenwart ist, wie die Zukunft – wenn nicht sogar wichtiger.
Doch wenn es um Neugeschäft geht, wenn wir über Disruption sprechen, über radikale Innovationen und Geschäftsmodelle, ignorieren wir die Vergangenheit zu gern. Ein Fehler?
Warum wir uns mehr mit der Geschichte beschäftigen sollten
Ich bin fest davon überzeugt, dass historische Analogien uns dabei helfen können, besser zu verstehen, wie sich die Zukunft entfalten könnte. Denn um klar zu sehen, wie die Dinge sind und wie sie sich entwickeln könnten, muss man wissen, wie sie entstanden sind.
Der ein oder andere mag jetzt vielleicht denken: „Was bringt es, zurückzublicken und sich in veraltete Sichtweisen zu vertiefen? Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Und wiederholen wollen wir den Großteil davon sowieso nicht. Wir wollen die Zukunft verändern.” Argument gewonnen.
Doch der Blick zurück ist und bleibt entscheidend für das Verständnis der Gegenwart und der Zukunft. Die Gegenwart ist das Erbe der Vergangenheit. Ich behaupte, die (nahe und ferne) Geschichte ermöglicht es uns, Muster zu entdecken, unsere Annahmen über die Gegenwart und Zukunft zu hinterfragen und nach Inspiration zu suchen, wie wir mit all der Transformation, dem ganzen Wandel und der ständigen Disruption besser umgehen können.
Muster des Wandels erkennen
Ein wesentlicher Vorteil des Blicks in den Rückspiegel besteht darin, dass man lernt, Muster des Wandels besser zu erkennen.
Alle wichtigen Trends unserer Zeit haben eine Geschichte. Manche sind sogar so langfristig und kontinuierlich am Wirken, dass sie ganze Epochen eingeleitet haben. Je nachdem, wie lange man bei der Beschäftigung mit der Zukunft zurückblickt, kann man so das Tempo der gegenwärtigen Veränderungen besser bestimmen sowie bessere Entscheidungen über Relevanz, Wirkung, Reifegrad und Potenzial treffen.
Wer über Musteränderungen im jetzt und hier spricht, sollte dies auf der Grundlage vergangener Entwicklungen tun, bevor er oder sie Aussagen über die Zukunft trifft. Denn alles andere ist reine Spekulation.
Annahmen besser verstehen
Lernen wir zu verstehen, wie die Vergangenheit die Gegenwart einschränkt oder prägt, können wir die Annahmen, Präferenzen und Überzeugungen, die als Grundlage für unsere Zukunftsvorstellungen dienen (und damit Grundlage für Geschäftsmodelle, Produkte und Strategien legen) besser analysieren.
Was uns unter anderem auch dabei helfen kann, Tabus schneller zu identifizieren und anzusprechen oder eben Alternativen für die Zukunft vorschlagen – der Klassiker ist sicherlich das überall bekannte „Das haben wir schon immer so gemacht” Argument.
Eine wichtige Voraussetzung für gute Entscheidungen ist das Verständnis der Beweggründe hinter früheren Entscheidungen. Wenn wir nicht verstehen, wie wir bis „hierher“ gekommen sind, laufen wir Gefahr, die Dinge noch viel schlimmer zu machen.
Der britische Schriftsteller G. K. Chesterton hat 1929 in einem Essay mal die Frage gestellt, was wir machen würden, wenn wir eine Straße entdecken, auf der ohne ersichtlichen Grund ein Zaun errichtet wurde. Viele würden ihn abreißen, weil es unnötig erscheint. Chesterton meint aber, wenn man nicht versteht, warum der Zaun da ist, kann man nicht darauf vertrauen, dass es in Ordnung ist, ihn abzureißen.
Viele Bräuche und Beweggründe von heute – dazu zähle ich auf Kundenverhalten, Vorlieben, Motivationen und andere Dinge – sind eben solche Zäune. Natürlich kann man jederzeit naiv reformieren und mit Transformation und grünem Wiesentheater prahlen. Man kann aber auch fragen, warum sich die Dinge so entwickelt haben, wie wir sie heute erleben.
Zukunft durch Geschichte erfahrbar gestalten
Ein weiterer Grund, regelmäßig zurückzublicken, ist die Inspiration, die wir aus der Vergangenheit ziehen können.
Geschichte ist im Gegensatz zu stumpfen Zukunftsvisionen und einfachen Zukunftsbildern detaillierter, lebendiger und zugänglicher. Auch, weil Technologien und Pfadabhängigkeiten im Nachhinein absurd leicht nachzuzeichnen sind.
Der Physiker Douglas R. Hofstaedter hat einmal gesagt: „Wir verstehen das Neue und Unbekannte im Zusammenhang mit dem Alten und Bekannten.” Analogien sind der Treibstoff und das Feuer des Denkens. Geschichte macht Veränderung – dem täglich Brot zukunftsorientierter Menschen – erfahrbar. Ist sie gut erzählt, vermittelt sie eingängig, wie man mit der Komplexität und Unsicherheit, die die Zukunft mit sich bringt, umgehen sollte.
Historische Analogien und Übersetzungen für die Gegenwart können uns deswegen dabei helfen, die großen und undurchsichtigen Bestandteile von Transformation besser zu verstehen, die uns heute so viele Bauchschmerzen bereiten. Auch können sie uns dabei helfen, Geschäftsmodelle besser zu beschreiben oder von einer Branche in eine andere zu übersetzen. Analogien sind trojanische Pferde. In den drei Worten „Uber für Babysitting“ stecken ganze Welten, die sofort von Dritten in den Kontext gesetzt werden können. Ohne die Vergangenheit wäre das unmöglich.
Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich
Mark Twain sagte scheinbar einmal: „History does not repeat itself, but it rhymes“.
Richtig eingesetzt, sind der historische Rückspiegel und die Suche nach Reimen in der Geschichte daher außerordentlich wirkungsvolle Instrumente. Man kann die Struktur vergangener Ereignisse nutzen, um die Punkte der gegenwärtigen Indikatoren zu verbinden und den Weg in die nahe Zukunft einigermaßen zuverlässig abzubilden – vorausgesetzt, man schaut weit genug zurück.
Denn das Problem mit der Geschichte ist, dass unsere Liebe zu Gewissheit und Kontinuität uns dazu verleitet, die falschen Schlüsse zu ziehen. Die jüngste Vergangenheit ist selten ein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Dennoch beziehen wir uns oft darauf.
Aber noch einmal: Geschichte wiederholt sich nicht. Wäre es so, könnte man ein Lineal an jede beliebige Entwicklung anlegen und den Trend einfach verlängern. Doch die Welt tickt nicht linear. Man muss nach Kurven, Mustern und Reimen suchen, nicht nach Geraden. Und dafür muss man manchmal etwas weiter in die Vergangenheit zurückblicken, als nur ins letzte Jahr.
Ich plädiere daher dafür, dass wir uns die Weisheit von Jobs und Noyce auch in der Digitalwirtschaft öfter ins Gewissen rufen sollen. Nehmen wir uns die Zeit, um zu verstehen, wie wir in den Schlamassel geraten sind, in dem wir uns heute befinden. Zumindest wird es uns helfen, aktuelle Entscheidungen besser einzuordnen, und wir können besser verstehen, wohin wir gehen wollen und gehen werden.


